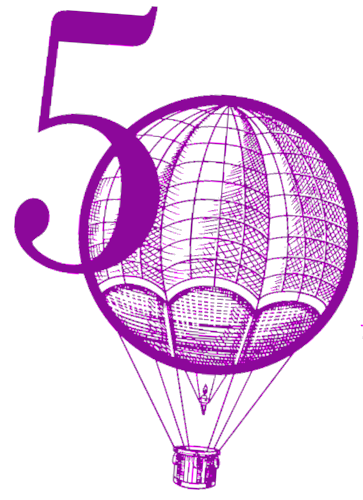Das Haus von Colette
Wenn die Sommerzeit der roten Früchte kommt, der milden Kräuter, der frischen Wasser, der länger werdenden Schatten, der irdischen Leckereien, der wunderbaren Pfirsiche, der goldig schönen Haut, der flüchtigen Liebe, der genießenden Katzen, die sich an der Sonne strecken, der verlängerten Mittagsruhen hinter den halbgeschlossenen Fensterläden, des schützenden Laubes, des unbekümmerten Wildes, der Pappeln, die in der Dämmerung wogen, der Tagesanbrüche, die nach Honig und Rose riechen, der trockenen Erde, sobald diese Sommerzeit mit all ihren Freuden, all ihren Erinnerungen da ist, dann muss man Sidonie-Gabrielle Colette wiederlesen. Die Bücher von Colette sind die ideale Begleitung in verdienten Pausen, sie sind die Komplizen des Glücks, die man dem anstrengenden Leben entreißen muss, sie zeigen das Innerste der Genesung, der Vergebung, der Hingabe in der fünfundzwanzigsten Stunde.
Man öffnet die Bücher von Colette mit einem befreienden Knarren, das ähnlich klingt, wie wenn bei einem über die Wintermonate verlassenen Ferienhaus die efeubewachsenen Fensterläden geöffnet werden. Man lässt Licht eindringen, vertreibt die Feuchtigkeit, hört die Sprache der unbelebten Dinge, weckt die schlafenden Körper. Mein Körper«, behauptete Colette, »ist intelligenter als mein Gehirn. Das ganze Werk von Colette ist voller Elan, voller Frechheit. Es verabscheut die Angepasstheit und den berüchtigten Intellektualismus
und feiert in einer Prosa, die ihrer Zeit voraus ist, die ausschweifenden Libertins, den sentimentalen Rückzug, das Vagabundentum, die Geburt des Tages, die irdischen Paradiese, die Nacktheit und sogar die Blüte des Alters. Man muss nur die Tiere hinzufügen, durch deren Gesellschaft der jugendliche Wildfang aus Puisaye sehr früh gelernt hatte zu miauen, schnurren, sammeln, beißen, fliegen, kriechen, schwimmen und, in ihren vielen Unterschlupfen, zu leiden ohne zu weinen, in aller Stille.
Zuerst gibt man La Paix chez les bêtes (Friede bei den Tieren) heraus, eine Sammlung von Kurzgeschichten, die Colette während des Ersten Weltkrieges und gegen ihn geschrieben hat. Colette hatte damals ihren zweiten Ehemann, alias Sidi, an der Front von Verdun besucht. Sie hatte beobachtet, wie Spatzen in den Kanonenrohren hausten, wie Eichhörnchen sich in den Gräben aufwärmten, wie Katzen durch den Kugelregen sprangen, wie Frontkämpfer Amseln beschützten und einem jungen Fuchs einen Teil ihrer Milch abgaben. Sie hatte den Anblick der Tiere, welche den menschlichen Hass ignorierten und durch ihre Verletzlichkeit zumindest um ein wenig Mitgefühl bettelten, bewundert: Eine Kopfbewegung, und sie waren vor dem mörderischen Krach gerettet.
In diesen Geschichten wird man auf eine sehr affektierte und eher tyrannische Perserkatze namens Shah treffen, die es gewohnt ist, aus einer chinesischen Schale zu fressen und aus einem venezianischen Glas zu trinken. Shah profitiert von den Ferien in der Bretagne, um seinem fürstlichen Reich zu entfliehen und sich auf eine Reise zu begeben, mit kerzengerade erhobenem Schwanz . Sie wird von den Maurern zu ihrem großen Glück mit ranzigem Speck und Wursthaut gefüttert. In einem Provinzcafé begegnen wir einem kleinen Mann, der Fische herunterschluckt und sie lebendig wieder zum Vorschein bringt, indem er den Bauch zuerst mit Wasser füllt: Ich könnte sie noch länger im Bauch behalten, aber das Publikum wird schnell ungeduldig, und der Goldfisch liebt die Dunkelheit sowieso nicht. Man wird im Zoo haltmachen, wo die eingesperrten Tiere eine ständige Kränkung erleben: Den Blick der Menschen. Aber ihre Rache ist, den Menschen einfach zu vergessen . Man sollte auch mit gesprächigen Hunden rechnen, einem blöde grinsenden Großherzogen, einem verlogenen Schwein, einem ängstlichen Bären und einer weißen Katze, die in einer Weihnachtsnacht ihre Haarpracht, ihr junges Blut und ihre Träume einem Soldaten anbietet, der starr in seinem Graben sitzt.
Am Ende ihres Lebens hatte Colette, die Tiere siezte, auf ihre Gesellschaft verzichtet. Sie ging so weit, dass sie den Tieren weder das Bild ihrer Gelähmtheit noch ihr eingeschränktes Leben zumuten wollte. Sie streichelte die Tiere nur noch in ihrem Gedächtnis. Sie rief sich die Kröte in Erinnerung, die zu singen begann, sobald sie sie am Kopf kratzte, den Igel, den sie mit kalten Wildfleisch überfütterte und der an einen Magenverstimmung starb, die Katze Péronelle, die ihr Kleines opferte, um im Schnee der Herrin auf die Pantomime-Tournée zu folgen. Mit einer von Resignation geprägten Heiterkeit erzählte Colette all das ins Mikrofon von André Parinaud. Das war im Jahre 1949, Colette war 66-jährig, sie hatte noch mehr als fünf Jahre zu leben.
Gefesselt an ihr Bett aufgrund einer Hüftarthrose, einen malvenfarbigen oder weißen Tüllschal um den Hals gebunden, das Gesicht mit starkem Kajalstift nachgezeichnet, silbrig-grau, mit Rouge und Lippenstift – Produkte, welche sie aus ihrem Schönheitssalon mitgenommen hatte empfing Colette den Radiojournalisten königlich im blauen Licht der Nachtischlampe im Zimmer des Palais-Royal, so, wie sie ihre Erinnerung an Saint-Sauveur, Rozven, Castel-Novel oder La Treille Muscat hervorholte und klassifizierte: ohne Rührung, schlagfertig und mit hoch erhobenem Kopf. Colette, die viel marschiert war, viel gegärtnert hatte, oft skifahren war, viel Komödie gespielt hatte, behielt von ihren vielen Leidenschaften nur diejenige für das gute Essen, bei dem keiner ihrer Freunde freiwillig fehlte. Eine Nachbarin brachte ihr gekochte Birnen, eine Bistrobetreiberin bot ihr gefüllte Crêpes an, Cocteau brachte Schokolade, und in Grand Véfour bereitete Raymond Oliver ihr Knoblauchgerichte zu – mit denen sie sich dopte.
In ihren Gesprächen mit Parinaud erinnert Collette daran, dass sie zur Clique von Saint-Sauveur gehörte und zur literarischen Familie der fröhlichen Pessimisten, dass sie Balzac verehrte und Willy verabscheute, dass sie sich nicht schämte, nackt aufzutreten, da sie sehr schön gebaut war, dass ihre Mutter den Geschmack ihrer Tugenden wahrnahm und dass sie während ihres ganzen Lebens den Morgen als Belohnung wahrnahm. Dies alles liest man, ohne überrascht zu sein, amüsiert sich deshalb aber nicht weniger. Kurz vor ihrem Tod traf man Colette noch am Fenster, das über die Gärten des Palais-Royal zeigte, mit wallendem Haar, einer Schottland-Decke um die Beine und einem Kugelschreiber in der Hand, noch immer genießerisch, sinnlich und junggeblieben wie früher. Als die ersten Sonnenstrahlen erschienen, reflektierten sie zuerst in ihrem Saphir, dann in ihren blaugrünen Augen, wo das Glück, gut gelebt zu haben, und der Stolz, nicht vergeblich dafür gekämpft zu haben, sich selbst treu zu bleiben, aufleuchtete.
L’Express, 4.7.1996