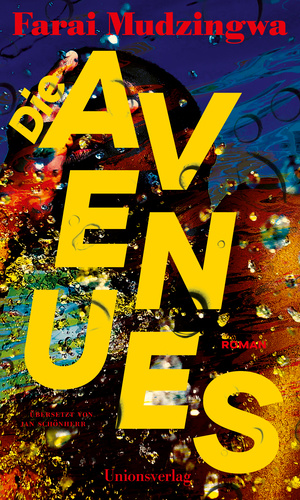Farai Mudzingwa
»Ich wünsche mir gut unterhaltene, schockierte und wütende Leser.«
Ein Gespräch
Die Avenues ist Ihr Debütroman – was hat Sie dazu gebracht, ihn zu schreiben?
Es gab verschiedene Einflüsse, die verschiedene Teile des Buchs inspirierten. So speisen sich die ersten Kapitel aus Erinnerungen an gewisse mysteriöse, ans Übernatürliche grenzende Ereignisse in meiner Kindheit. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in der die Grenzen zwischen Fakten und Folklore fließend waren. Im Roman habe ich versucht, diese Weltsicht damit in Einklang zu bringen, wie ich unser Land und seine Menschen heute verstehe.
Wie hängt der englische Titel Avenues by Train mit der Geschichte zusammen?
Einer der Mythen, die ich als Kind oft hörte, drehte sich um die Eisenbahn. Geschichten von Gespenstern an den Gleisen, von Menschen, die dort ums Leben kamen. Außerdem sind die Gleise als Grenze zwischen Vorstadt und Ghetto auch eine Metapher für Reisen und Exil, für Aufbruch. Songs wie »Chitima Nditakure« von Thomas Mapfumo oder »Stimela« von Hugh Masekela ließen diese Motive in mir Gestalt annehmen. Die andere Seite von Aufbruch, von Flucht, ist das Ziel, und das Avenues-Viertel in Harare war der Anlaufpunkt für alle, die nach ihrem Glück und den Lichtern der Großstadt suchten. Außerdem verströmen die Avenues eine Art mystischer Aura: Die Straßen sind tagsüber schattig und nachts kaum beleuchtet. Das Viertel ist im Wandel, koloniale Gebäude weichen neuerer Architektur, Gewerbegebäude werden an Ecken voller Straßenhändler und Sexarbeiterinnen errichtet. Also ein Ort voller Widersprüche, für Menschen auf der Suche nach sich selbst, die sich dort entweder finden oder für immer verlieren.
Sie schreiben über das befreite Simbabwe und über die Traumen der Kolonialzeit. Worum ging es Ihnen bei der Betrachtung der Auswirkungen des Kolonialismus auf die Einzelnen?
Mein Ziel war, eine gewisse Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu überbrücken. Weder die heutigen Simbabwer noch unser Zeitalter existieren nur für sich. Es gibt da eine Kontinuität. Wir leben dieselben Leben wie unsere Vorfahren, und wir bereiten den Weg für unsere Nachkommen. Alles hängt zusammen. Man neigt heute dazu, vergangene Ereignisse als klar getrennt von dem zu betrachten, was jetzt geschieht. Ich wollte zeigen, dass wir alle mit den Konsequenzen des Vergangenen leben. Dass wir auch individuell mit den Folgen dessen leben, was die taten, die vor uns da waren. Allerdings möchte ich auch die Hoffnung nähren, dass wir Heutigen auch selbst unsere Gegenwart UND unsere Zukunft schaffen können. Dabei können und sollten wir jedoch von denen lernen, die vor uns da waren: von unseren Ahnen.
Die Geschichte im Buch dreht sich um Jedzas Befreiung von einem Ngozi, einem Rachegeist, durch spirituelle Praktiken. Was steckt hinter Ihrer Entscheidung, afrikanische Spiritualität und Kultur in den Blick zu nehmen?
Afrikanische Spiritualität wurde in der Vergangenheit regelmäßig verzerrt und verteufelt, dabei verfügen wir über einen Schatz an praktischem und theoretischem Wissen, den sonst niemand hat, und der sich überall auf der Welt integrieren lässt. Jedzas Weg zeigt, wie wir uns mit uns selbst aussöhnen, unsere traditionelle Kultur wiederentdecken und sie mit unseren modernen Leben in Einklang bringen können. Die alten Praktiken sind ein Fundament, von dem aus wir der Welt zu unseren Bedingungen begegnen können, statt zu fremden, von den Kolonisten übernommenen.
Immer wieder kommt in Ihrem Buch Musik vor. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Roman und für Ihr Schreiben?
Musik ist für mich die vielleicht wichtigste Inspiration – vor allem Mbira-Musik, mit ihrer zyklischen, immmergleiche Akkordfolgen wiederholenden Form, in der sich verschiedene Melodien verflechten. Daraus entsteht eine Art Melodiemosaik, in dem man jeweils den Strängen folgen kann, die einen am stärksten ansprechen. Literarisch gesagt versuche ich, Metaphern, Motive und andere Stilmittel so einzusetzen, dass der Leser diverse Narrative und Themen wahrnehmen kann – mal das eine, mal eher das andere, je nachdem, welcher Linie man folgt. Letztlich hinterlässt Musik vor allem ein Gefühl. Auch wenn man Text und Akkorde vergisst, wenn man sich nur bruchstückhaft an Melodie oder Refrain erinnert, das Gefühl beim Hören bleibt. Dasselbe möchte ich gern bei meinen Lesern bewirken.
Ihr Buch steckt voller Anspielungen auf simbabwische Geschichte sowie Kultur und Spiritualität der Shona. Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?
Ich habe viele Monate im Nationalarchiv und anderen Archiven verbracht. Außerdem haben andere Autoren und Wissenschaftler ihre Ergebnisse mit mir geteilt. Und ich habe – kritisch, natürlich –, den Kanon anthropologischer Schriften gelesen, Terence Ranger, David Norman Beach, David Lan, Peter Fry, Michael Gelfand, Paul Berliner etc., dazu Literatur simbabwischer Autorinnen und Autoren wie Solomon Mutswairo, Yvonne Vera, Shimmer Chinodya und vieler anderer, die sich mit Shona-Spiritualität beschäftigt haben. Zusätzlich habe ich diverse Filme, Musik und sonstige Medien über den Umgang mit Geistern – vor allem mit welchen aus dem Wasser – in anderen Kulturen der Welt rezipiert.
Glücklicherweise ist die Kultur der Shona noch sehr lebendig. In mancher Hinsicht ist sie vom Kolonialismus beschädigt und marginalisiert worden; auf jeden Fall gilt das für den urbanen Raum, wo sie dem traditionellen und evangelikalen Christentum weichen musste. Je weiter man aber aufs Land fährt, desto stärker findet man sie wieder. Ich hatte das Glück, in der Stadt Freunde zu haben sowie Künstler und Praktikzierende kennenzulernen, von denen ich lernen und dank denen ich an einigen Zeremonien teilnehmen konnte. Das half mir, alte Aufzeichnungen besser zu verstehen und damit zu verknüpfen, wie Shona-Spiritualität heute gelebt wird.
Ein besonderes Element Ihres Romans sind die launigen Fußnoten, mit denen Sie uns durch das Buch führen. Inwiefern trägt das Ihrer Ansicht nach zum Leseerlebnis bei?
Die Fußnoten sind meine Art, die Leser anzustupsen und ihnen ins Ohr zu flüstern. Während sie lesen, tippe ich ihnen quasi auf die Schulter und verrate ihnen pikante Details und Insider-Infos. Sie sollen von all dem irren Kram erfahren, der rings um das passiert, was auf der Seite los ist. Nur einen Moment lang will ich mit ihnen einen Schritt zurücktreten und den Kopf über das schütteln, was hinter der Geschichte steht.
Wie fühlt es sich an, ihr Buch jetzt endlich veröffentlicht zu sehen? Und was hoffen Sie, dass Ihre Leser daraus mitnehmen?
Aufregend fühlt es sich an! Sehr sogar! Und die Menschen, die es lesen, werden danach hoffentlich hinterfragen, was sie zu wissen glaubten, was sie für selbstverständlich hielten. Idealerweise legen sie das Buch irgendwann weg und Dinge schlagen ein paar Dinge nach, mit denen sie bisher nur wenig oder gar nicht zu tun hatten. Haben mehr und detailliertere Fragen über Dinge, Themen, Orte und Menschen, die sie sonst übersehen hätten. Ich wünsche mir gut unterhaltene, schockierte und wütende Leser. Ich wünsche sie mir hoffnungsvoll und mitfühlend. Ich wünsche mir, dass sie stolz auf ihr afrikanisches Erbe sind und einen positiven Bezug zu ihrem Afrikanischsein haben.
Die Avenues ist Ihr Debütroman – was hat Sie dazu gebracht, ihn zu schreiben?
Es gab verschiedene Einflüsse, die verschiedene Teile des Buchs inspirierten. So speisen sich die ersten Kapitel aus Erinnerungen an gewisse mysteriöse, ans Übernatürliche grenzende Ereignisse in meiner Kindheit. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in der die Grenzen zwischen Fakten und Folklore fließend waren. Im Roman habe ich versucht, diese Weltsicht damit in Einklang zu bringen, wie ich unser Land und seine Menschen heute verstehe.
Wie hängt der englische Titel Avenues by Train mit der Geschichte zusammen?
Einer der Mythen, die ich als Kind oft hörte, drehte sich um die Eisenbahn. Geschichten von Gespenstern an den Gleisen, von Menschen, die dort ums Leben kamen. Außerdem sind die Gleise als Grenze zwischen Vorstadt und Ghetto auch eine Metapher für Reisen und Exil, für Aufbruch. Songs wie »Chitima Nditakure« von Thomas Mapfumo oder »Stimela« von Hugh Masekela ließen diese Motive in mir Gestalt annehmen. Die andere Seite von Aufbruch, von Flucht, ist das Ziel, und das Avenues-Viertel in Harare war der Anlaufpunkt für alle, die nach ihrem Glück und den Lichtern der Großstadt suchten. Außerdem verströmen die Avenues eine Art mystischer Aura: Die Straßen sind tagsüber schattig und nachts kaum beleuchtet. Das Viertel ist im Wandel, koloniale Gebäude weichen neuerer Architektur, Gewerbegebäude werden an Ecken voller Straßenhändler und Sexarbeiterinnen errichtet. Also ein Ort voller Widersprüche, für Menschen auf der Suche nach sich selbst, die sich dort entweder finden oder für immer verlieren.
Sie schreiben über das befreite Simbabwe und über die Traumen der Kolonialzeit. Worum ging es Ihnen bei der Betrachtung der Auswirkungen des Kolonialismus auf die Einzelnen?
Mein Ziel war, eine gewisse Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu überbrücken. Weder die heutigen Simbabwer noch unser Zeitalter existieren nur für sich. Es gibt da eine Kontinuität. Wir leben dieselben Leben wie unsere Vorfahren, und wir bereiten den Weg für unsere Nachkommen. Alles hängt zusammen. Man neigt heute dazu, vergangene Ereignisse als klar getrennt von dem zu betrachten, was jetzt geschieht. Ich wollte zeigen, dass wir alle mit den Konsequenzen des Vergangenen leben. Dass wir auch individuell mit den Folgen dessen leben, was die taten, die vor uns da waren. Allerdings möchte ich auch die Hoffnung nähren, dass wir Heutigen auch selbst unsere Gegenwart UND unsere Zukunft schaffen können. Dabei können und sollten wir jedoch von denen lernen, die vor uns da waren: von unseren Ahnen.
Die Geschichte im Buch dreht sich um Jedzas Befreiung von einem Ngozi, einem Rachegeist, durch spirituelle Praktiken. Was steckt hinter Ihrer Entscheidung, afrikanische Spiritualität und Kultur in den Blick zu nehmen?
Afrikanische Spiritualität wurde in der Vergangenheit regelmäßig verzerrt und verteufelt, dabei verfügen wir über einen Schatz an praktischem und theoretischem Wissen, den sonst niemand hat, und der sich überall auf der Welt integrieren lässt. Jedzas Weg zeigt, wie wir uns mit uns selbst aussöhnen, unsere traditionelle Kultur wiederentdecken und sie mit unseren modernen Leben in Einklang bringen können. Die alten Praktiken sind ein Fundament, von dem aus wir der Welt zu unseren Bedingungen begegnen können, statt zu fremden, von den Kolonisten übernommenen.
Immer wieder kommt in Ihrem Buch Musik vor. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Roman und für Ihr Schreiben?
Musik ist für mich die vielleicht wichtigste Inspiration – vor allem Mbira-Musik, mit ihrer zyklischen, immmergleiche Akkordfolgen wiederholenden Form, in der sich verschiedene Melodien verflechten. Daraus entsteht eine Art Melodiemosaik, in dem man jeweils den Strängen folgen kann, die einen am stärksten ansprechen. Literarisch gesagt versuche ich, Metaphern, Motive und andere Stilmittel so einzusetzen, dass der Leser diverse Narrative und Themen wahrnehmen kann – mal das eine, mal eher das andere, je nachdem, welcher Linie man folgt. Letztlich hinterlässt Musik vor allem ein Gefühl. Auch wenn man Text und Akkorde vergisst, wenn man sich nur bruchstückhaft an Melodie oder Refrain erinnert, das Gefühl beim Hören bleibt. Dasselbe möchte ich gern bei meinen Lesern bewirken.
Ihr Buch steckt voller Anspielungen auf simbabwische Geschichte sowie Kultur und Spiritualität der Shona. Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?
Ich habe viele Monate im Nationalarchiv und anderen Archiven verbracht. Außerdem haben andere Autoren und Wissenschaftler ihre Ergebnisse mit mir geteilt. Und ich habe – kritisch, natürlich –, den Kanon anthropologischer Schriften gelesen, Terence Ranger, David Norman Beach, David Lan, Peter Fry, Michael Gelfand, Paul Berliner etc., dazu Literatur simbabwischer Autorinnen und Autoren wie Solomon Mutswairo, Yvonne Vera, Shimmer Chinodya und vieler anderer, die sich mit Shona-Spiritualität beschäftigt haben. Zusätzlich habe ich diverse Filme, Musik und sonstige Medien über den Umgang mit Geistern – vor allem mit welchen aus dem Wasser – in anderen Kulturen der Welt rezipiert.
Glücklicherweise ist die Kultur der Shona noch sehr lebendig. In mancher Hinsicht ist sie vom Kolonialismus beschädigt und marginalisiert worden; auf jeden Fall gilt das für den urbanen Raum, wo sie dem traditionellen und evangelikalen Christentum weichen musste. Je weiter man aber aufs Land fährt, desto stärker findet man sie wieder. Ich hatte das Glück, in der Stadt Freunde zu haben sowie Künstler und Praktikzierende kennenzulernen, von denen ich lernen und dank denen ich an einigen Zeremonien teilnehmen konnte. Das half mir, alte Aufzeichnungen besser zu verstehen und damit zu verknüpfen, wie Shona-Spiritualität heute gelebt wird.
Ein besonderes Element Ihres Romans sind die launigen Fußnoten, mit denen Sie uns durch das Buch führen. Inwiefern trägt das Ihrer Ansicht nach zum Leseerlebnis bei?
Die Fußnoten sind meine Art, die Leser anzustupsen und ihnen ins Ohr zu flüstern. Während sie lesen, tippe ich ihnen quasi auf die Schulter und verrate ihnen pikante Details und Insider-Infos. Sie sollen von all dem irren Kram erfahren, der rings um das passiert, was auf der Seite los ist. Nur einen Moment lang will ich mit ihnen einen Schritt zurücktreten und den Kopf über das schütteln, was hinter der Geschichte steht.
Wie fühlt es sich an, ihr Buch jetzt endlich veröffentlicht zu sehen? Und was hoffen Sie, dass Ihre Leser daraus mitnehmen?
Aufregend fühlt es sich an! Sehr sogar! Und die Menschen, die es lesen, werden danach hoffentlich hinterfragen, was sie zu wissen glaubten, was sie für selbstverständlich hielten. Idealerweise legen sie das Buch irgendwann weg und Dinge schlagen ein paar Dinge nach, mit denen sie bisher nur wenig oder gar nicht zu tun hatten. Haben mehr und detailliertere Fragen über Dinge, Themen, Orte und Menschen, die sie sonst übersehen hätten. Ich wünsche mir gut unterhaltene, schockierte und wütende Leser. Ich wünsche sie mir hoffnungsvoll und mitfühlend. Ich wünsche mir, dass sie stolz auf ihr afrikanisches Erbe sind und einen positiven Bezug zu ihrem Afrikanischsein haben.