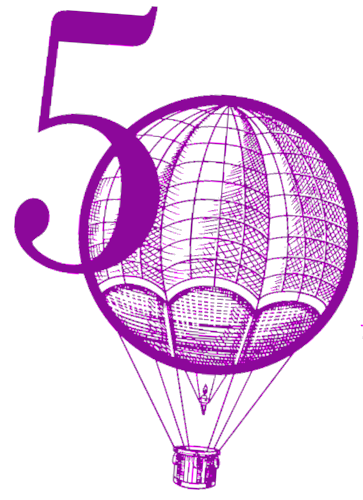Ines Anselmi
Beobachter, Zuhörer und Vollblutmusiker
Über Colin McPhee und sein Abenteuer in Bali
Ein Haus in Bali dreht sich um ein faszinierendes Abenteuer. Es beginnt, als Colin McPhee zum ersten Mal ein balinesisches Gamelan-Orchester hört: 1929 auf einer Schallplattenaufnahme in New York und dann wieder 1930 live an der Weltausstellung in Paris. Er ist so bezaubert von dieser Musik, dass sich ihre Erforschung fortan zu seiner Obsession entwickelt. 1931 schifft er sich nach Bali ein, baut später ein Haus in der Nähe von Ubud und lebt bis Ende 1938 die meiste Zeit dort. Colin McPhee – Weltmusiker avant la lettre – hat für die balinesische Musik in den 1930er Jahren getan, was ein Ry Cooder in den 1990er Jahren für die traditionelle kubanische Son-Musik tun wollte: er hat sie vor dem Vergessen gerettet und neu belebt.
Colin McPhee findet über die Musik einen ganz eigenen Zugang zu den Menschen in Bali und ihrer Kultur. Das Buch lässt den Leser teilnehmen an den Abenteuern des Autors, der genießerisch und mit wundervollem Humor auskostet und beschreibt, was ihn diese Insel erleben lässt – das Essen, das Feiern, das Reisen durch die Landschaft, das Kampieren in der Natur, das Zusammensein mit Freunden. Bali steht noch unter holländischer Kolonialherrschaft. Dass es sich nicht schickt, mit Einheimischen von gleich zu gleich zu verkehren, kümmert McPhee wenig. Er schließt Freundschaft mit balinesischen Musikern und Komponisten, behandelt die Hausangestellten wie Familienmitglieder, fördert manches Talent.
Als genauer Beobachter, aufmerksamer Zuhörer und Vollblutmusiker nimmt er am Alltag und am zeremoniellen Leben der Inselbewohner teil und vermittelt in seinem Buch außerordentliche Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart ihrer Kultur. Seine Unvoreingenommenheit, Neugier und Liebe zu den Künsten öffnen ihm die Türen. Er studiert die lokalen Musik- und Tanztraditionen, reist bis in die entlegensten Winkel der Insel, um die letzten noch lebenden Meister der alten Gamelan-Musik aufzusuchen, die verschiedenen Stilrichtungen, Musikstücke und Instrumente kennenzulernen. Das Gehörte setzt er in intensiver Zusammenarbeit mit balinesischen Musikern in Notenschrift um, transkribiert ausgewählte Gamelan-Stücke für westliche Instrumente oder spielt sie den verblüfften Zuhörern gleich selber auf dem Piano vor. Er gibt den Anstoß zur Gründung mehrerer Orchester, darunter eines für Kinder, um das Fortleben der Gamelan-Musik auf Bali zu fördern. Ein ganzes Kapitel ist diesem Kinderorchester gewidmet, in dem Sechs- bis Zwölfjährige das von Generation zu Generation überlieferte Repertoire des Gamelan Angklung erlernen. Ein anderes Kapitel schildert den Werdegang des Bauernjungen Sampih, den der Autor in sein Haus aufnimmt und zum Tänzer ausbilden lässt, nachdem ihn dieser aus den gefährlich ansteigenden Fluten eines Flusses rettete.
Geldnot und die politischen Umstände zwingen McPhee kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, Bali zu verlassen und in die USA zurückzukehren. In den folgenden Jahren beginnt er, wenn der Existenzkampf in verschiedenen Brotberufen es ihm erlaubt, sein umfangreiches Forschungsmaterial aus Bali und Java zu ordnen und weiterzubearbeiten. Sein Opus Magnum, Music in Bali, kommt erst 1966 posthum heraus.
McPhees Reise- und Erfahrungsbericht, den er A House in Bali tauft, erscheint hingegen schon 1946/47 in den USA und in Kanada und erhält begeisterte Rezensionen. Die erste Auflage ist schnell vergriffen, doch die Papierknappheit der Nachkriegszeit verzögert das Erscheinen einer zweiten Auflage so lange, dass das Buch fast in Vergessenheit gerät. Verzweifelt schreibt McPhee einem Freund: »I had hoped A House in Bali would have helped open some doors. I don’t know why, but I might just as well have never written it.« Den späteren Erfolg seines Buches konnte McPhee nicht voraussehen. Es wurde 1980 in den USA, 2003 in Italien und ab 2000 in Asien in mehreren Auflagen neu aufgelegt und ist ein Longseller.
A House in Bali gilt als Klassiker der Reiseliteratur und steht in diesem Genre doch einzigartig da. Lange bevor sich McPhee als Schriftsteller betätigte, gehörte er im New York der Zwanzigerjahre als Komponist, Pianist und Musikrezensent zur musikalischen Avantgarde. Der musikalische Hintergrund ist seiner Sprache anzuhören, sie ist von seltener Klarheit, rhythmisch und melodiös strukturiert. Der schnörkellose Stil erinnert an die Minimal Music.
Im Herbst 2015 erscheint das Buch erstmals in deutscher Übersetzung. Fast siebzig Jahre nach der englischen Erstveröffentlichung hat Ein Haus in Bali seine Frische bewahrt. McPhees Blick auf Bali wirkt erstaunlich modern. Viele seiner Beobachtungen balinesischer Traditionen treffen auch auf das heutige Bali noch zu. Die vorurteilsfreie weltoffene Haltung des Autors einer fremden Kultur gegenüber ist für die damalige Zeit allerdings ungewöhnlich. Auf Bali regierten die Holländer und kontrollierten den Umgang mit Einheimischen. Zum Beispiel setzte sich McPhee bei Autofahrten gerne nach vorne neben den Chauffeur, um sich mit ihm zu unterhalten. Damit verstieß er gegen die herrschende Etikette: »Der Hoteldirektor missbilligte das sehr. Denn diese kleine Geste bedeutete offenbar etwas Unziemliches, möglicherweise Wohlwollen, Vertrautheit, oder noch schlimmer, Gleichheit, eine vom kolonialen Standpunkt aus abscheuliche Vorstellung. ›Sie müssen Distanz halten‹, mahnte der Direktor, ›der angemessene Platz für einen weißen Mann ist der Rücksitz. Früher haben Holländer Eingeborene geheiratet; heute ist das anders. Gehen Sie mit ihnen ins Bett, wenn Sie möchten, aber achten Sie darauf, dass sie durch den Hintereingang eintreten.‹«
Ein Haus in Bali dreht sich um ein faszinierendes Abenteuer. Es beginnt, als Colin McPhee zum ersten Mal ein balinesisches Gamelan-Orchester hört: 1929 auf einer Schallplattenaufnahme in New York und dann wieder 1930 live an der Weltausstellung in Paris. Er ist so bezaubert von dieser Musik, dass sich ihre Erforschung fortan zu seiner Obsession entwickelt. 1931 schifft er sich nach Bali ein, baut später ein Haus in der Nähe von Ubud und lebt bis Ende 1938 die meiste Zeit dort. Colin McPhee – Weltmusiker avant la lettre – hat für die balinesische Musik in den 1930er Jahren getan, was ein Ry Cooder in den 1990er Jahren für die traditionelle kubanische Son-Musik tun wollte: er hat sie vor dem Vergessen gerettet und neu belebt.
Colin McPhee findet über die Musik einen ganz eigenen Zugang zu den Menschen in Bali und ihrer Kultur. Das Buch lässt den Leser teilnehmen an den Abenteuern des Autors, der genießerisch und mit wundervollem Humor auskostet und beschreibt, was ihn diese Insel erleben lässt – das Essen, das Feiern, das Reisen durch die Landschaft, das Kampieren in der Natur, das Zusammensein mit Freunden. Bali steht noch unter holländischer Kolonialherrschaft. Dass es sich nicht schickt, mit Einheimischen von gleich zu gleich zu verkehren, kümmert McPhee wenig. Er schließt Freundschaft mit balinesischen Musikern und Komponisten, behandelt die Hausangestellten wie Familienmitglieder, fördert manches Talent.
Als genauer Beobachter, aufmerksamer Zuhörer und Vollblutmusiker nimmt er am Alltag und am zeremoniellen Leben der Inselbewohner teil und vermittelt in seinem Buch außerordentliche Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart ihrer Kultur. Seine Unvoreingenommenheit, Neugier und Liebe zu den Künsten öffnen ihm die Türen. Er studiert die lokalen Musik- und Tanztraditionen, reist bis in die entlegensten Winkel der Insel, um die letzten noch lebenden Meister der alten Gamelan-Musik aufzusuchen, die verschiedenen Stilrichtungen, Musikstücke und Instrumente kennenzulernen. Das Gehörte setzt er in intensiver Zusammenarbeit mit balinesischen Musikern in Notenschrift um, transkribiert ausgewählte Gamelan-Stücke für westliche Instrumente oder spielt sie den verblüfften Zuhörern gleich selber auf dem Piano vor. Er gibt den Anstoß zur Gründung mehrerer Orchester, darunter eines für Kinder, um das Fortleben der Gamelan-Musik auf Bali zu fördern. Ein ganzes Kapitel ist diesem Kinderorchester gewidmet, in dem Sechs- bis Zwölfjährige das von Generation zu Generation überlieferte Repertoire des Gamelan Angklung erlernen. Ein anderes Kapitel schildert den Werdegang des Bauernjungen Sampih, den der Autor in sein Haus aufnimmt und zum Tänzer ausbilden lässt, nachdem ihn dieser aus den gefährlich ansteigenden Fluten eines Flusses rettete.
Geldnot und die politischen Umstände zwingen McPhee kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, Bali zu verlassen und in die USA zurückzukehren. In den folgenden Jahren beginnt er, wenn der Existenzkampf in verschiedenen Brotberufen es ihm erlaubt, sein umfangreiches Forschungsmaterial aus Bali und Java zu ordnen und weiterzubearbeiten. Sein Opus Magnum, Music in Bali, kommt erst 1966 posthum heraus.
McPhees Reise- und Erfahrungsbericht, den er A House in Bali tauft, erscheint hingegen schon 1946/47 in den USA und in Kanada und erhält begeisterte Rezensionen. Die erste Auflage ist schnell vergriffen, doch die Papierknappheit der Nachkriegszeit verzögert das Erscheinen einer zweiten Auflage so lange, dass das Buch fast in Vergessenheit gerät. Verzweifelt schreibt McPhee einem Freund: »I had hoped A House in Bali would have helped open some doors. I don’t know why, but I might just as well have never written it.« Den späteren Erfolg seines Buches konnte McPhee nicht voraussehen. Es wurde 1980 in den USA, 2003 in Italien und ab 2000 in Asien in mehreren Auflagen neu aufgelegt und ist ein Longseller.
A House in Bali gilt als Klassiker der Reiseliteratur und steht in diesem Genre doch einzigartig da. Lange bevor sich McPhee als Schriftsteller betätigte, gehörte er im New York der Zwanzigerjahre als Komponist, Pianist und Musikrezensent zur musikalischen Avantgarde. Der musikalische Hintergrund ist seiner Sprache anzuhören, sie ist von seltener Klarheit, rhythmisch und melodiös strukturiert. Der schnörkellose Stil erinnert an die Minimal Music.
Im Herbst 2015 erscheint das Buch erstmals in deutscher Übersetzung. Fast siebzig Jahre nach der englischen Erstveröffentlichung hat Ein Haus in Bali seine Frische bewahrt. McPhees Blick auf Bali wirkt erstaunlich modern. Viele seiner Beobachtungen balinesischer Traditionen treffen auch auf das heutige Bali noch zu. Die vorurteilsfreie weltoffene Haltung des Autors einer fremden Kultur gegenüber ist für die damalige Zeit allerdings ungewöhnlich. Auf Bali regierten die Holländer und kontrollierten den Umgang mit Einheimischen. Zum Beispiel setzte sich McPhee bei Autofahrten gerne nach vorne neben den Chauffeur, um sich mit ihm zu unterhalten. Damit verstieß er gegen die herrschende Etikette: »Der Hoteldirektor missbilligte das sehr. Denn diese kleine Geste bedeutete offenbar etwas Unziemliches, möglicherweise Wohlwollen, Vertrautheit, oder noch schlimmer, Gleichheit, eine vom kolonialen Standpunkt aus abscheuliche Vorstellung. ›Sie müssen Distanz halten‹, mahnte der Direktor, ›der angemessene Platz für einen weißen Mann ist der Rücksitz. Früher haben Holländer Eingeborene geheiratet; heute ist das anders. Gehen Sie mit ihnen ins Bett, wenn Sie möchten, aber achten Sie darauf, dass sie durch den Hintereingang eintreten.‹«